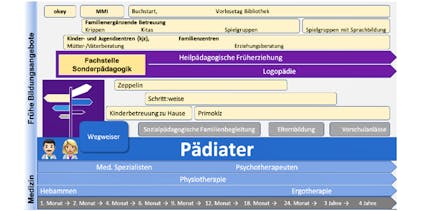Einleitung
Ob digitale Medien zu einem entwicklungsförderlichen Alltag von Kindern beitragen können oder deren Entwicklung primär gefährden, ist in der Medienwirkungsforschung nach wie vor umstritten 1). Noch viel uneiniger darüber ist man sich aber in der Erziehungspraxis. Der Trend geht hier in Richtung einer kulturpessimistischen Haltung, die von populärwissenschaftlichen Publikationen wie denjenigen des Hirnforschers und Psychiaters Manfred Spitzer unterfüttert wird 2). Zugleich wird die Digitalisierung der Gesellschaft öffentlich zum erstrebenswerten Megatrend erklärt und Wirtschaft sowie Bildungssystem rufen nach einem intensiveren Einsatz digitaler Medien in allen Lebensbereichen, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten 3). Die heutigen Eltern junger Kinder sind selbst mit digitalen Medien aufgewachsen und nutzen sie selbstverständlich in ihrem Alltag. Als Eltern sind sie aber oft verunsichert, welche Form der Mediennutzung bei Anwesenheit des Kindes angemessen ist oder wo sie ihr Medienverhalten kritisch hinterfragen müssten. Das beginnt bei „Stunde Null“: Hebammen machen sich Sorgen über den Umgang mit Smartphones im Gebärsaal 4). Werdende Mütter setzen zwischen den Wehen Chat-Nachrichten ab, um ihr soziales Umfeld am Ereignis live teilhaben zu lassen. Anwesende Väter sind im Dilemma was zuerst kommt: ein Selfie mit Mutter und Baby oder eine zärtliche Kontaktaufnahme via Berührung? Die gross angelegte BLIKK-Studie in Deutschland 2016-17 liefert erste Hinweise auf möglicherweise negative Einflüsse des Umgangs mit mobilen digitalen Medien auf die Bindungsentwicklung sowie Fütter- und Einschlafstörungen von Säuglingen 5). Über 5500 Kinder wurden im Rahmen der Früherkennungsuntersuchungen durch Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte zu ihrem Medienumgang und gesundheitlichen Merkmalen befragt. Allerdings ist die Art des Zusammenhangs wohl komplexer als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Hier müssen weitere Analysen der Daten abgewartet werden. Die öffentliche Diskussion erster Befunde tendiert zu methodisch unzulässigen Verkürzungen, was nicht zuletzt der Aufmerksamkeitslogik der Medien geschuldet ist.
In jeder Entwicklungsphase des Kindes muss neu abgewogen werden, welcher Medienumgang sinnvoll ist und wo die Risiken und Chancen liegen 6). Dabei ist es wichtig, einen differenziellen Blick einzunehmen. Dass man Kleinkinder nicht sich selbst überlassen soll, indem man sie stundenlang allein mit einem Tablet oder Smartphone spielen lässt, ist fraglos richtig 7). Aber Eltern, die auf eine solche Idee kommen, haben wohl generell eine andere Beziehung zu ihrem Kleinkind und zu ihrer Erziehungs- und Betreuungsaufgabe als andere Eltern. Die Mediennutzung des jeweiligen Kindes entwickelt ein positives oder negatives Potenzial in Abhängigkeit von Persönlichkeit, sozialem Umfeld und vom Gesamtspektrum der Aktivitäten, welchen das Kind nachgeht. Wollen wir die Mediennutzung eines Kindes verstehen, so dürfen wir uns also nicht auf die Medienaktivitäten beschränken, sondern müssen ein Gesamtbild des Kindes, seiner Kompetenzen und seines Kontextes erfassen.
Studien zum Medienalltag
Als Fachperson (Kinderärztin, Schulpsychologe, etc.) bekommt man meist nicht das ganze Spektrum der Mediengewohnheiten von Kindern in den Blick, sondern nur dasjenige von Kindern mit bestimmten Auffälligkeiten. Daher ist es hilfreich, Studien zu kennen, welche repräsentative Einblicke in die Mediennutzung vermitteln (siehe Internet-Links unten). Für Deutschland sind dies die Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest: KIM, JIM, FIM und MiniKIM, für die Schweiz sind es die MIKE- und die JAMES-Studie, die an der ZHAW seit 2010 durchgeführt werden. Ein noch breiteres Bild zu über 20 Ländern vermitteln die Studien EU-Kids online und das Forschungsnetzwerk Global Kids online. Ergänzende Einblicke für die Schweiz bieten qualitative Studien wie die ADELE-Studie und Generation Smartphone. Diese Studien zeigen sowohl die Chancen als auch die Risiken der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen auf und können den allenfalls vorschnellen Verallgemeinerungen, die aus Alltagsbeobachtungen oder klinischen Kontexten erfolgen, etwas entgegenhalten. Fragt man zum Beispiel 6- bis 13-jährige Kinder in der Schweiz nach ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen, dann kommt nicht Gamen oder Handynutzung an erster Stelle, sondern Spielen mit Freunden, Freizeitsport treiben wie Fussball spielen 8). Auch das Lesen von Büchern erhält einen hohen Stellenwert. Dies zeigt die Wordcloud in Abbildung 1 : Je grösser ein Wort dargestellt ist, desto mehr Kinder haben es als liebste Freizeitaktivität genannt.
Auch bei Jugendlichen zeigt sich ein ähnliches Bild, insbesondere wenn es darum geht, was sie am liebsten tun, wenn sie mit Freunden zusammen sind (Abbildung 2). Wobei das Gamen einen höheren Stellenwert einnimmt als bei den Kindern. Sobald Dating und Partys bei den Jugendlichen aktuell werden, verliert das Gamen allerdings bei den meisten wieder an Bedeutung 9).


Trends der letzten Jahre
Betrachtet man im Verlauf mehrerer Jahre, wie sich die Freizeitgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen wandeln, dann stellt man zuerst einmal sehr viel Konstanz fest. Obwohl die digitalen Medien sich immer weiter verbreiten und Kinder in immer jüngerem Alter Zugang zu ihnen haben, bleiben viele Freizeitmuster auffällig konstant. Das zeigen auch die deutschen JIM-Studien, die bereits auf 20 Jahre regelmässiger Erhebungen bei Jugendlichen zurückgreifen können 10). Zudem zeigt sich immer wieder, dass der Medienumgang der Eltern und derjenige ihrer Kinder miteinander korrelieren. Auf der einen Seite nutzen Eltern Medien gemeinsam mit ihren Kindern, auf der anderen Seite lassen sie Kindern mit einem Medium mehr Freiraum, wenn sie das Medium selbst gerne nutzen und positiv bewerten. Computerspiele werden von Eltern mit der höchsten Skepsis betrachtet. Gamen wird als Zeitverschwendung eingeschätzt, es herrscht Angst vor, dass das Kind in eine suchtartige Nutzung gerät und es wird eine negative Wirkung von Gewaltinszenierungen befürchtet. Fernsehen, Internetnutzung, Bücher lesen und Musik hören sind sowohl bei Eltern als auch bei Kindern sehr beliebt und regelmässig genutzt, während Computerspiele viel stärker von Kindern allein und Radio viel eher von Eltern allein genutzt werden. Der Kinobesuch ist anfangs ein Familienprogramm, wird ab der Pubertät der Kinder aber zunehmend ein Event unter Gleichaltrigen. Genauso ist das Handy zu Beginn der kindlichen Nutzung ein Medium, mit dem sich Kinder und Eltern vernetzen und damit mehr Flexibilität für beide Seiten gewinnen, während es später primär der Peerkommunikation und Unterhaltung dient. Video-Portale wie YouTube gehören heute bei Kindern und Jugendlichen zu den beliebtesten Websites und Apps. Sie werden immer vielfältiger genutzt: Nicht nur für Musik, Filme und Serien, sondern auch für das Suchen von Informationen und Wissensinhalten, zum Beispiel für Hausaufgaben. Dabei sind Visual Literacy und Informationskompetenz notwendig, um die Glaubwürdigkeit von Quellen und Inhalten abschätzen zu können. Die blosse Häufigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der digitale Medien genutzt werden, garantieren keinen kritischen und kompetenten Umgang. Ohne Medienerziehung in den Familien und Medienbildung an den Schulen bleibt die Nutzung naiv. Sogenannte „Digital Natives“ sind da anderen Generationen in keiner Weise überlegen 11).
Ambivalenzen der permanenten Erreichbarkeit
Manche Eltern schenken ihrem Kind schon früh ein Smartphone, weil sie es dadurch mittels einer App permanent überwachen können. So fühlen sie sich sicher, dass dem Kind nichts zustösst und sie jederzeit ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Das GPS-Tracking findet manchmal offen deklariert, aber manchmal auch ohne das Wissen des Kindes statt. Für die Entwicklung von Selbstverantwortung und Vertrauen ist das besonders hinderlich. „Helikopter-Eltern“ sind wohl aber generell ängstlicher und misstrauischer, was sich auf die Kinder übertragen wird und sie langfristig in ihrer Autonomie-Entwicklung beeinträchtigt, mit oder ohne GPS-Tracking. Überbehütete Kinder trauen sich selbst weniger zu, werden ängstlicher und entwickeln ein Erfahrungsdefizit im Explorieren der Welt.
Ein wichtiges Thema im Kontext des mobilen Internetzugangs ist es, wie man mit der Verteilung der Aufmerksamkeit zwischen face-to-face präsenten Personen und dem potenziell jederzeit digital ansprechbaren sozialen Netzwerk umgeht 12). Das Phänomen, dass sich jemand ignoriert fühlt, weil das Gegenüber sich durch Smartphone-Signale ablenken lässt, wird als „Phubbing“ bezeichnet, eine Wortneuschöpfung aus „Phone“ und „Snubbing“: Aufs Handy schauen und dem Gegenüber keine Aufmerksamkeit schenken. Kinder und Jugendliche müssen lernen, wie sie mit diesen Verlockungen umgehen. Das Vorbildverhalten der erwachsenen Bezugspersonen ist hier wichtig, aber auch die Peergruppe entwickelt informelle Regeln, was man als angemessen empfindet und was als unhöflich 13). Für Eltern von Kleinkindern kann es eine psychohygienische Funktion haben, bei der Kinderbetreuung zwischendurch auch andere Kontakte pflegen zu können und sich nicht isoliert zu fühlen in der Betreuungsrolle. Genauso kann es für pubertierende Kinder hilfreich sein, wenn sie in Familienferien zwischendurch – in klar vereinbarten Zeitfenstern – digital mit ihren Freunden kommunizieren können. So werden sie lieber etwas mit der Familie unternehmen, als wenn sie dann strikt vom Freundeskreis abgehängt sind. Problematisch wird es, wenn Menschen deshalb immer wieder online gehen müssen, weil sie Angst haben, sonst etwas zu verpassen (Fear of missing out, FOMO). Dies kann zu einem suchtartigen Verhalten im Umgang mit digitalen Medien führen. Es ist Ausdruck eines geringen Selbstwertgefühls und eines Zweifels am Wohlwollen der Bezugspersonen und Freunde. FOMO kann aber auch entstehen, nachdem ein Kind Cybermobbing erlebt hat und nun ständig in Sorge ist, erneut auf Online-Kanälen angegriffen zu werden. Es ist also auf jeden Fall wichtig, den Ursachen des Kontrollverlustes im Umgang mit der permanenten Erreichbarkeit nachzugehen.
In Familien, Institutionen und Arbeitsteams müssen Regeln ausgehandelt werden, wie man die digitale Erreichbarkeit gestalten will. Menschen brauchen Phasen der erlaubten Nicht-Erreichbarkeit. Markierungen von Übergängen sind wichtig, nicht nur im Freundeskreis, sondern auch in Lern- und Arbeitsverhältnissen. Wenn Eltern jederzeit für ihren Arbeitgeber erreichbar sein müssen, dann können sie auch ihren Kindern nicht plausibel machen, weshalb sie für ihre Freunde nicht jederzeit ansprechbar sein sollen.
Ein gutes Leben on- und offline
Wenn man eine kulinarische Metapher verwenden möchte, dann kann man Medien als Lebensmittel, Genussmittel und Suchtmittel bezeichnen. In unserer digitalen Mediengesellschaft ist die Sozialisation zu einem handlungsfähigen Mitgestalter des eigenen Lebens und der Gesellschaft nur möglich, wenn man sich der Potenziale der Medien zu bedienen weiss und mit den Risiken kompetent umzugehen lernt. Dazu braucht es Medien-, Selbst- und Sozialkompetenz. Mediengenussfähigkeit ist eine Komponente von Medienkompetenz. Die Kritikfähigkeit allein öffnet nicht den Zugang zu den modernen Kulturtechniken. Digitale und analoge Medien erzählen die grossen und kleinen Geschichten der Menschheit, können zur Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben anregen und sind Ausdrucksmittel für kreative Prozesse. Zugleich können Medien Entwicklungsschritte erschweren oder die Kreativität zurückdrängen, wenn sie einseitig und suchtartig genutzt werden 14). Digitale Spielwelten, soziale Netzwerke, Glücksspiele und sexuelle Darstellungen können in besonderem Masse zu Verhaltenssucht führen.
Um Kinder, Jugendliche und Eltern in ihrem Medienumgang zu beraten, ist es hilfreich, den Blick darauf zu richten, wie Lebensqualität und Entwicklung in einem optimalen Mix von medialen und nonmedialen Aktivitäten gefördert werden. Dieser optimale Mix ist nicht allein damit zu erreichen, dass man die Medienzeit möglichst einschränkt, sondern indem man unvoreingenommen fragt, welche Bedürfnisse, Fähigkeiten und Leidenschaften mit bestimmten (nonmedialen und medialen, analogen und digitalen) Aktivitäten eines Kindes (oder eines Elternteils) verbunden sind. Ein entspannter Umgang mit Medien, aber auch ein selbstkritischer Austausch über die Medienerfahrungen aller Familienmitglieder, kann eine gute Balance im Alltag unterstützen. Übungen und Anregungen dazu, die auch Spass machen können, finden sich zum Beispiel im Ratgeber des Psychiaters Jan Kalbitzer 15) und im Ratgeber des Medienpädagogen Detlef Scholz 16).
Internet-Links zu Studien und Materialien
www.jugendundmedien.ch
Netzwerk des Bundes zur Förderung von Medienkompetenzen und zum Jugendmedienschutz.
www.mpfs.de
Studien aus Deutschland zum Medienalltag von Kleinkindern (Mini-KIM), Kindern (KIM), Jugendlichen (JIM) und Familien (FIM).
www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/
Studien aus der Schweiz zum Medienalltag von Kleinkindern (ADELE), Primarschulkindern (MIKE) und Jugendlichen (JAMES).
www.generationsmartphone.ch
Bericht zum Umgang von Schweizer Jugendlichen mit dem Smartphone, Video- und Bildmaterial als Anregung für die Medienbildung.
www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online
Europäisches Forschungsnetzwerk EU-Kids online und Global Kids online.
Referenzen
- Süss D, Lampert C, Trültzsch-Wijnen C. Medienpädagogik. Ein Studienbuch zur Einführung. 3., aktualisierte Auflage. Wiesbaden, Springer VS, 2018.
- Spitzer M. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. München, 2012.
- Genner S. Digitale Transformation. Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in der Schweiz – Ausbildung, Bildung, Arbeit, Freizeit. Bericht zuhanden der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Zürich: ZHAW, 2017.
- Baumann S, Seiler L. Smartphone – der ständige Begleiter beeinflusst die Mutter-Kind-Beziehung. Hebamme.ch, (12), 2017: 8-11.
- Riedel R, Büsching U, Brand M. BLIKK-Medien: Kinder und Jugendliche im Umgang mit elektronischen Medien. Abschlussbericht. Universität Duisburg-Essen und RFH Köln. 2018, Online: https://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Berichte/Abschlussbericht_BLIKK_Medien.pdf.
- Willemse I. Altersgerechter Medienkonsum. Wie kann man dieses Ziel erreichen? Pädiatrie, 3, 2018: 12-16.
- Tisseron S. Kampf dem Missbrauch von Bildschirmen: Kinderärzte an vorderster Front. Paediatrica, 29 (4), 2018: 9-12.
- Genner S, Suter L, Waller G, Schoch P, Willemse I, Süss D. MIKE – Medien, Interaktion, Kinder, Eltern. Ergebnisbericht der MIKE-Studie 2017. Zürich, ZHAW, 2017. Online: www.zhaw.ch/psychologie/mike
- Suter L, Waller G, Bernath, J, Külling, C, Willemse, I, Süss, D. JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Ergebnisbericht der JAMES-Studie 2018. Zürich, ZHAW, 2018. Online: www.zhaw.ch/psychologie/james.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. JIM-Studie 2018. Jugend, Information, Medien. Online: www.mpfs.de/studien/jim-studie/2018/.
- Schulmeister R. Vom Mythos der Digital Natives und der Net Generation, BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 2012 (3): 42-46. Online: https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/bwp/show/6871.
- Genner S. On/Off – Risks and rewards of the Anytime-Anywhere Internet. Zürich, vdf, 2017.
- Genner S, Suter L. Generation Smartphone. 900 Tage Smartphone-Nutzung Jugendlicher: Chancen, Risiken und Dilemmata. merz medien + erziehung (5), 2018: 62-68.
- Willemse I. Onlinesucht. Ein Ratgeber für Eltern, Betroffene und ihr Umfeld. Bern, Hogrefe, 2016.
- Kalbitzer J. Digitale Paranoia. Online bleiben, ohne den Verstand zu verlieren. München, C.H. Beck, 2017.
- Scholz D. #Familie – Entspannter Umgang mit digitalen Medien. Heidelberg, Carl Auer, 2016.